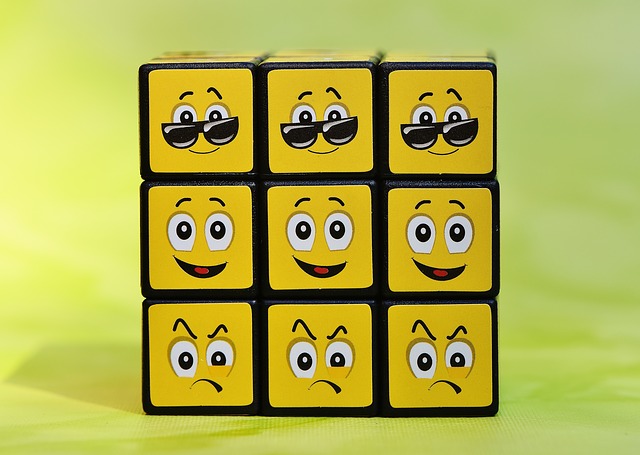Warum Metaphern aus der Jagd der Vergangenheit angehören
Das Denken in Zielgruppen, die „anvisiert“ und dann „zur Strecke gebracht“ werden, ist heute überholt. In der neuen Wirtschaft sind Kunden keine Beute und Verkäufer keine Jäger mehr. Die Metaphern aus der Jagdsprache spiegeln nur das Denken herkömmlicher Vertriebler. Der PreSales-Marketeer jedoch geht genau umgekehrt vor: Er macht sich selbst zur Zielgruppe für die Kunden. Auf Leuchtturm-Unternehmen kommen Kunden aktiv zu, und sie „jagen“ ihrerseits nach dem besten Angebot.
Die Zielgruppe ist ohnehin eine veraltete Kategorie. Das Marketing danach auszurichten ist reine Energieverschwendung. Die Gesellschaft ist derart individualisiert, dass es kaum mehr einheitliche Käufergruppen gibt. Jeder hat seine ganz persönlichen Ansprüche, die er dank eines vielfältigen globalen Marktes auch verwirklichen kann. Wer in dem Schubladendenken der Zielgruppe gefangen ist, läuft Gefahr, potentielle Kunden, die sich darin nicht einordnen lassen, zu übersehen.
Deshalb wurde die Idee der Zielgruppe abgelöst von der Vorstellung von Lebensstiltypen. Die Theorie besagt, dass Menschen, die einen ähnlichen Lebensstil pflegen, denken ähnlich und ähnliche Kaufinteressen haben. Ein Lebensstiltyp ist eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamer Grundhaltung und gemeinsamen Werten. Ein Beispiel ist der „LOHA“, der einen „Lifestyle of Health and Sustainability“ pflegt. Diese Menschen sind darum bemüht, durch ihr Konsumverhalten und die gezielte Auswahl Gesundheit und Nachhaltigkeit zu fördern. 44 Prozent der Bundesbürger identifizieren sich mit diesem Typ, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos Ende 2008 ergab.
Aber auch der Lebensstil sagt nicht immer viel aus. Einzelne Phänomene ziehen sich heute durch alle Käufergruppen. So werden Harry-Potter-Bücher von mehreren Millionen Menschen in aller Welt gelesen, und zwar von Kindern und Eltern, von Hauptschülern und Akademikern. Der Rückschluss, dass alle Leser den gleichen Lebensstil pflegen und daher neben Harry Potter auch weitere gemeinsame Interessen haben, ist jedoch falsch.
Also greift auch dieses Konzept zu kurz. Im vorigen Kapitel habe ich gezeigt, wie Unternehmen ihre Zielgruppe anhand öffentlich zugänglicher Daten filtern. Tupper etwa würde seine Werbemaßnahmen eher an eine Hausfrau als an einen Vorstandsvorsitzenden richten. Als Filter dient in diesem Fall die Berufsbezeichnung. Demnach würde eine Hausfrau als potentieller Kunde gelten, ein Konzernchef aber nicht. Was aber, wenn der Vorstandsvorsitzende des Konzerns begeisterter Koch ist und seine hochwertigen Lebensmittel gerne in Tupperdosen aufbewahrt? Dann hätte Tupper einen kaufkräftigen Kunden ignoriert.
Das Denken in Zielgruppen verengt die Sichtweise. Viele Menschen, die zu den potentiellen Kunden gehören, werden durch das herkömmliche Marketing von vornherein ausgeschlossen.
Das PreSales Marketing hingegen verwandelt das Unternehmen in die Zielgruppe. Statt zu angeln, arbeite ich mit Schleppnetzen. Ich werfe Köder aus, um potentielle Kunden auf mein Angebot aufmerksam zu machen. Dabei spreche ich gezielt Grundbedürfnisse meiner potentiellen Kunden an, etwa den Wunsch nach Sicherheit oder nach Entspannung. Wenn ich Tupper bewerben sollte, würde ich auf den Wunsch anspielen, das Leben möglichst einfach zu gestalten – die Tupperware hilft beim Organisieren der Vorräte und erleichtert das Haushalten. Das ist viel effektiver, als mit der Qualität der Dosen zu werben. Denn so werden auch Kunden bei mir landen, die vorher gar nicht wussten, dass sie Tupperware brauchen. Eventuell wird ein Bastler Tupperware kaufen, um seinen Vorrat an Schrauben neu zu ordnen. So gewinne ich Kunden, die ich bei einer Zielgruppenanalyse niemals gefunden hätte.
Bedarfsgruppen statt Zielgruppen
Jemand, der den Impuls verspürt, seinen Körper zu entschlacken und sein Leben besser zu organisieren, möchte vielleicht auch sein Haus entrümpeln und seine Versicherungen überprüfen lassen. Ein Versicherer könnte diesen Zusammenhang nutzen und auf Webseiten für Entgiftungskuren, Fastenwandern oder für Wellnessaufenthalte werben mit einem Slogan wie: „Entschlacken Sie Ihre Versicherungen.“
Die Botschaft der Werbung lautet dann: „Wir helfen Ihnen, Ihre Wünsche wahr werden zu lassen.“ Der Kunde, der nach „entschlacken“ im Internet suchte, bedachte vielleicht gar nicht, dass er gerne auch seine Versicherungen neu ordnen würde. Dabei geht mit dem Wunsch nach körperlicher Entschlackung häufig auch der Wunsch einher, im gesamten Leben aufzuräumen und Überflüssiges über Bord zu werfen. Daher passt das Angebot, die eigenen Versicherungen auf doppelte Absicherungen zu überprüfen und überteuerte Angebote durch günstigere zu ersetzen, genau in diesen Zusammenhang. Der Interessent für Entschlackungskuren wird deshalb gerne das Angebot des Versicherers annehmen, der diese Verbindung erkannt hat. Solche Angebote nerven nicht, denn sie treffen genau den Bedarf des Kunden.
Anstelle von Zielgruppen sollten Unternehmen daher an Bedarfsgruppen denken. Bedarfsgruppen umfassen Personen unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen Lebensstilen und Berufen. Die Jugendlichen von heute schließen auch Bausparverträge ab, während einst nur Ältere eine solche Art der Vorsorge wählten. Senioren wiederum gehen nicht nur in den Park, sondern immer häufiger auch surfen. Daher ist es schwer geworden, seine Zielgruppe zu kennen. Außerdem sind viele Angebote nicht auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten. Ein Webdesigner etwa weiß nicht, wem er seine Angebote unterbreiten soll, denn sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen und Vereine brauchen Internetseiten. Die Zielgruppe eines Webdesigners ist also riesig und unüberschaubar.
Zielgruppen werden durch die Brille des Unternehmers erkannt. Die Einteilung in Bedarfsgruppen aber benutzt die Brille des Kunden. Und weil der Kunde selbst am besten weiß, ob und welchen Bedarf er hat, unterbleibt für die Unternehmen das große Rätselraten der Zielgruppenanalyse.
Ein Versicherungsvertreter, der Bedarfsgruppen anspricht, könnte neben dem Thema „Entschlacken“ auch das Thema „Sicherheit“ bewerben. Junge Leute etwa sehnen sich in der Phase der Familiengründung nach Sicherheit. Also sind sie interessiert daran, Versicherungen abzuschließen, die bisher nicht nötig waren.
Die Angst vor dem Datenklau
Finanzinstitute und Versicherungen analysieren regelmäßig den Markt und bilden Bedarfsgruppen. Sie sammeln Kundendaten und setzen alles daran, maßgeschneiderte Angebote zu unterbreiten. Verbraucherschützer schreien dann mitunter Alarm. Dabei sind die Bedenken, die angesichts solcher Datensammlungen geäußert werden, recht kindisch, denn die Privatsphäre wird in der Regel nicht berührt.
Viele Menschen sind heute dazu bereit, Informationen über sich preiszugeben – wenn sie wissen, wozu diese verwendet werden. Warum sollten sie es auch nicht tun? Wer einen Teil seines Lebens transparent macht, bekommt viel eher Angebote, die ihn interessieren. Heute müssen wir nur deshalb noch im Internet nach Angeboten suchen, weil niemand erkennt, was wir eigentlich brauchen.
Wenn meine Frau hochschwanger durch die Stadt läuft, ist für jeden ersichtlich, dass wir Nachwuchs erwarten. In dieser Lage sind wir offen für Anbieter, der uns Testberichte und Preisvergleiche von Kinderwagen und Kindersitzen zukommen lässt. Angesichts der stressigen Phase, in der wir unser Leben neu organisieren, um das Kind willkommen zu heißen, haben wir wenig Zeit, diese Recherchen selbst zu machen. Über einen solchen Service wäre ich daher so begeistert, dass ich sofort kaufen würde. Mehr noch: Ich würde zusätzlich Angebote für ein Kinderbett und Babysachen einholen.
Der Anbieter hat den Zustand meiner Frau offensichtlich erkannt. Aber in meiner Privatsphäre fühle ich mich dadurch nicht gestört. Deshalb halte ich auch die Angst vor einer Sammelwut von Daten für unbegründet. Ich bin ohnehin seit meiner Geburt aktenkundig. Mein Personalausweis führt mein Geburtsdatum, meine Größe und meine Augenfarbe auf.
Heutzutage glauben viele Menschen, ihre Privatsphäre beschützen zu müssen, obwohl es nichts Intimes zu schützen gibt. Damit verkennen sie den Nutzen, den Datensammlungen ihnen als Kunden bieten. Wenn die Sparkasse weiß, welcher Kunde soeben eine Familie gegründet hat, dann weiß sie auch, dass dieser eher an einer Lebensversicherung als an einem Hedge Fonds interessiert ist.
Natürlich, auch hinter maßgeschneiderten Angeboten ist die Verkaufsabsicht spürbar. Amazon zeigt mir nur deshalb Hinweise auf Bücher an, die mit meiner aktuellen Suche verwandt sind, weil das Versandhaus mir etwas verkaufen will. Aus demselben Grund senden sie mir auch E-Mails mit Sammelangeboten aus den Kategorien, aus denen ich schon gekauft habe. Na und? Ich muss ja nicht wieder kaufen, ich kann die Mail auch löschen. Aber wenn ein Restaurant notiert, dass ich eine Getreideallergie habe und bei meinem nächsten Besuch darauf Rücksicht nimmt, bin ich begeistert. Ich muss nämlich den Kellner nicht zum zehnten Mal darauf hinweisen, welche Speisen ich nicht vertrage.
Der bekannte Schindlerhof in Nürnberg, der für seinen Service bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, geht sogar noch einen Schritt weiter: Die Bücher aus der hoteleigenen Bibliothek schlagen die Hotelliers auf der Seite auf, wo der Gast beim letzten Besuch aufgehört hat zu lesen.
Alle diese Angebote sind gut gemacht, da sie dem Kunden nutzen. Der Nutzen muss allerdings immer deutlich sein, sonst wird ein solches Vorgehen eher abgelehnt. Stark kritisiert wurde, dass Facebook Userdaten an Dritte verkauft. Die einen schrien auf, die anderen zuckten mit den Schultern und verstanden nicht, was die ganze Aufregung soll. Die hitzige Debatte ist jedoch nur entstanden, weil Facebook nicht deutlich kommuniziert hat, wo der Nutzen für die Teilnehmer liegt. Es war also ein Kommunikationsproblem. Hätten die User gewusst, welchen Vorteil sie davon haben, dass Dritte ihre Daten erhalten, hätten sie sich niemals aufgeregt.
Natürlich dürfen nicht alle persönlichen Daten offengelegt werden. Für mich endet die Transparenz beispielsweise, wenn meine Kinderkrankheiten im Internet aufgelistet werden. Wenn sie aber auf einer verschlüsselten Seite stünden, die nur Ärzten zugänglich wäre, dann wäre ich damit einverstanden. Ich müsste nicht bei jedem Arztbesuch meine ganze Geschichte von Neuem erzählen.
PreSales Marketing arbeitet jedoch weder mit Zielgruppen noch mit selbst erstellten Bedarfsgruppen. Beim PreSales Marketing sorgt das eigene Netzwerk dafür, dass sich die Bedarfsgruppen automatisch beim Anbieter melden. Allerdings funktioniert das System nur, wenn die Qualität des Produkts den Kundenerwartungen entspricht. Stimmt diese nicht, so verwandelt sich das selbstverstärkende System des PreSales Marketing in ein selbstzerstörendes System.
Denn ein schlechter Ruf spricht sich genauso schnell herum wie ein guter Ruf. Davon zeugt etwa der Misserfolg der Mercedes A-Klasse beim sogenannten Elch-Test. Der Test ist in Schweden vorgeschrieben. Dabei wird simuliert, dass ein Kind plötzlich auf die Straße springt und der Autofahrer ausweichen muss. 1997 scheiterte Mercedes daran. Das kurze, aber hohe A-Modell kippte bei diesem Test um. Die PR-Abteilung von Mercedes nannte den Test daraufhin „Elch-Test“, um anzudeuten, dass es sich um einen ganz unwahrscheinlichen Fall handele. Doch aller PR-Aufwand blieb vergeblich. Das auf dem deutschen Markt vielbeworbene Modell hatte keine Absatzchance mehr. In Schweden erhielt sie kurz nach dem Elch-Test den Spitznamen „Vält-Klasse“ – ausgesprochen wie „Weltklasse“ bedeutet die Wortschöpfung „Umkippklasse“. Erst als Mercedes nachrüstete und der A-Klasse das damals noch seltene EPS-System spendierte, kam der Verkauf endlich in Gang.
Als Anbieter muss ich sicher sein, dass meine Produkte einem Qualitätstest standhalten. Erst dann kann ich das Schleppnetz auswerfen, um potentielle Kunden zu finden. Das funktioniert am besten in den sozialen Netzwerken des Internets.
Wenn ich potentielle Kunden erstmals anspreche, stelle ich ihnen etwa ein kostenloses E-Book zur Verfügung. Hat jemand wirklich Interesse an meinem Angebot, so erkenne ich das daran, dass er das E-Book anfordert. Allerdings muss er mir im Gegenzug auch etwas geben, zum Beispiel seine E-Mail-Adresse. Gibt er sie mir nicht, dann hat er kein Interesse. In der Folge werden nur noch diejenige angesprochen, die Interesse an meinem Angebot gezeigt haben. Die Tatsache, dass sich ein potentieller Kunde durch meine Aktivitäten angesprochen fühlt, sagt mehr über ihn aus als alle Statistiken oder Einteilungen in Zielgruppen. Durch eine stetige Beziehungspflege, bei der ich immer darauf achte, dass die Beziehungskonten im Plus bleiben, bringe ich die Kunden zu einem Geschäftsabschluss. Durch dieses Vorgehen erspare ich mir die Suche nach Zielgruppen. Die Kunden gesellen sich selbst zu einer Bedarfsgruppe und kaufen bei mir, weil bereits eine Beziehung aufgebaut wurde.